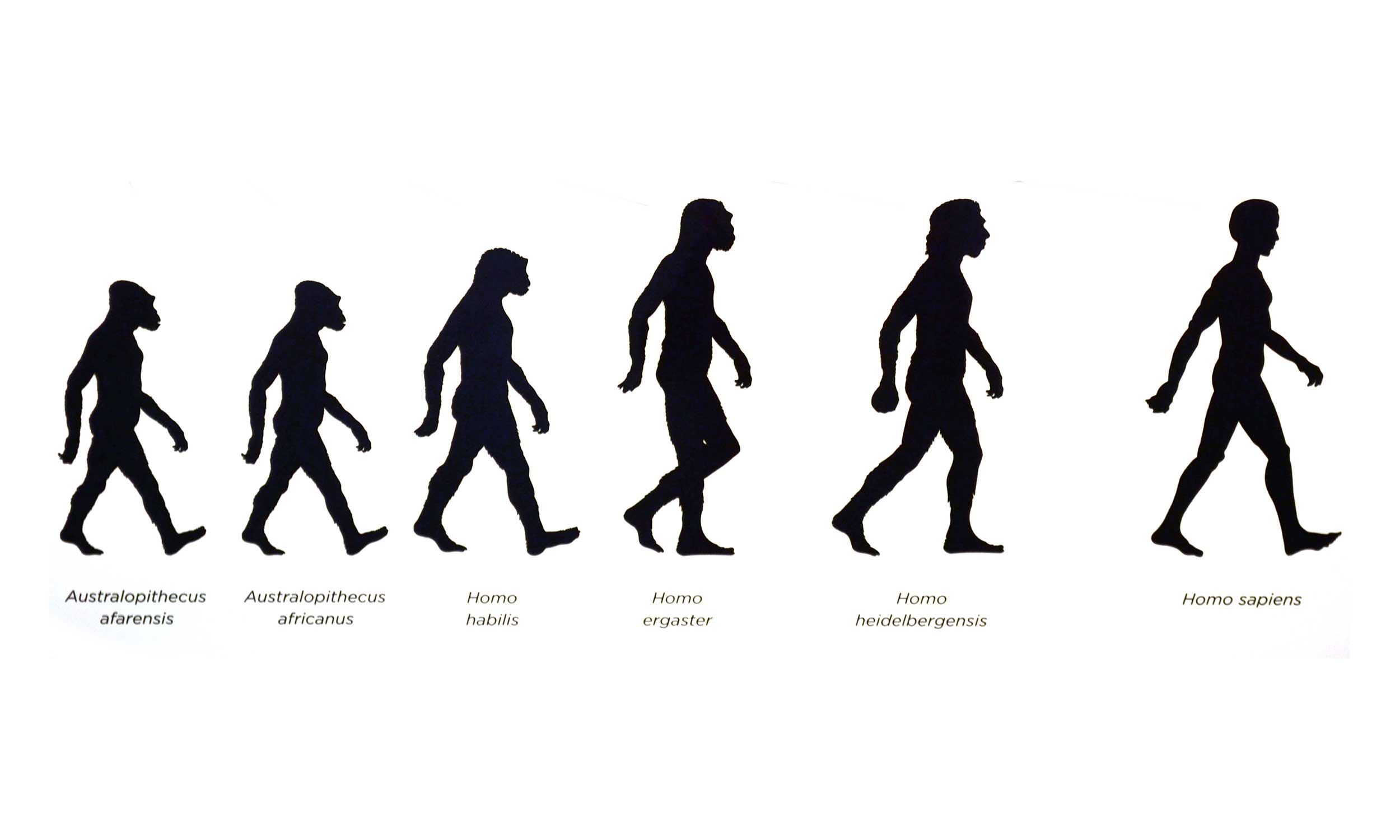
Neben der Archäologie und der Theologie gehört auch die Anthropologie zu den Hochburgen des Patriarchats. Hand in Hand verteidigen sie die falsche Lehre der weiblichen Bedeutungslosigkeit. Frauen werden in der Menschheitsgeschichte und in der Gottesgeschichte unsichtbar gemacht durch die haltlose Behauptung: der Mann stand schon immer im Zentrum von Geschichte und Religion.
Die neuesten Erkenntnisse der interdisziplinären Patriarchatskritikforschung strafen diese Ideologien Lügen und entlarven deren Dogmen als Bastionen patriarchaler Definitions- und Ordnungsmacht, um männliche Herrschaftsmacht zu legitimieren.
Das Virtuelle Museum www.herstory-history.com korrigiert die falschen Lehren des Patriarchats und lenkt den Blick auf die ursprüngliche Bedeutung der Mütter, nicht als passives, auf Kinder reduziertes Gefäß des Mannes, sondern als Trägerinnen menschlicher Kultur und Religion.
Die Entwicklung des emotional modernen Menschen
Menschliche Kultur in ihren Ursprüngen zeigt sich nach den neusten Erkenntnissen der Soziobiologie, entgegen der üblichen evolutionspsychologischen Beschreibungen, in denen Aggression und Killerinstinkte in der Evolutionsanthropologie einen großen Raum einnehmen, als das Gegenteil, nämlich als friedlich, empathisch, altruistisch, schenkbereit und hypersozial. Das patriarchale Paradigma, den Mann als Dreh- und Angelpunkt der Evolution ins Zentrum zu setzen, verstellte nur den Blickwinkel auf den tatsächlichen Ursprung der menschlichen Evolution, in der die Mütter im Zentrum standen. Die amerikanische Anthropologin und Primatenforscherin Sarah Blaffer Hrdy, die den „emotional modernen Menschen“ in die wissenschaftliche Diskussion einbringt, schreibt:
„Evolutionär gesehen, sind anatomisch und verhaltensmäßig moderne Menschen bemerkenswert jung. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass emotional moderne Menschen viel älter sind. Mit „emotional modern“ meine ich jene zweibeinigen Menschenaffen, die mit der Bereitschaft zu teilen und mit empathischen, intersubjektiven Fähigkeiten geboren wurden, welche sich tiefgreifend von jenen unterschieden, wie wir sie bei heutigen Schimpansen beobachten“. (Blaffer Hrdy, Sarah, Mütter und Andere, 2009, S. 98).
Auf die ungewöhnlichen intersubjektiven Fähigkeiten des Menschen hatte erstmals Michael Tomasello, der amerikanische Leiter der Leipziger Forschungsgruppe für Entwicklungspsychologie mit seinen MitarbeiterInnen hingewiesen und im Jahr 2005 hatten sie eine neue Trennlinie zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Menschenaffen vorgeschlagen. Sie schrieben:
„Wir sind der Auffassung …, dass der entscheidende Unterschied zwischen der Kognition des Menschen und der anderer Arten die Fähigkeit ist, an gemeinschaftlichen Aktivitäten mit gemeinsamen Zielen und Intentionen mitzuwirken. Im Augenblick kennzeichnet dieses Merkmal zusammen mit unserem außergewöhnlich großen Gehirnvolumen und unserem Sprachvermögen die neue Trennlinie, die uns von anderen Menschenaffen unterscheidet. Entsprechend sind Menschen und nur Menschen darauf ausgelegt, an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen, die gemeinsame Ziele und sozial koordinierte Handlungspläne umfassen“. (zit. Aus Blaffer Hrdy: Mütter und Andere, 2009, S. 22/23).
In ihrem die Menschheitsgeschichte revolutionierenden Buch „Mütter und Andere“, in dem Blaffer Hrdy den wissenschaftlichen Beweis führt, wie die Evolution den Menschen zu sozialen Wesen machte, weist sie schon in ihrem einführenden Text auf eine dringend notwendige andere Sichtweise in der anthropologischen und soziobiologischen Wissenschaft hin. Sie schreibt:
„Die Tatsache, dass Kinder so sehr auf Nahrung angewiesen sind, die andere beschaffen, ist ein Grund weshalb diejenigen, die nach allgemeinen menschlichen Merkmalen suchen, gut beraten wären, mit der Bereitschaft zum Teilen zu beginnen“. (ebenda, S. 34).
Die Wissenschaftlerin führt weiter aus:
„Das Teilen von Nahrung mit unreifen Individuen, die zu jung sind, um sich selbst zu versorgen oder die Nahrung richtig zu verwerten, ist ein entscheidendes, aber oft übersehenes Kapitel der menschlichen Entwicklungsgeschichte… Bei keiner anderen Art aber sind unreife Individuen, was ihre Ernährung betrifft, jahrelang so sehr auf andere angewiesen wie beim Menschen“. (ebenda, S. 116).
Das ist der Grund warum hominine Kleinkinder unter anderen Bedingungen aufwuchsen als die Nachkommen aller anderen Primaten. Sie schreibt:
„Vermutlich bereits vor 1,8 Millionen Jahren wurden hominine Junge neben der Mutter von einer ganzen Reihe weiterer Individuen umsorgt und ernährt, und diese Aufzuchtbedingungen schufen die Voraussetzung für das Auftreten eines emotional modernen Menschenaffen“. (ebenda, S. 99).
Aus dieser Tatsache entwickelt sich beim Menschen ein besonders ausgeprägtes kooperatives Aufzuchtverhalten, das die Fürsorge und die Ernährung der Jungen auf mehrere Schultern verteilt. (ebenda, S. 118). Dieses kooperative Aufzuchtverhalten des Menschen unterscheidet sich signifikant von dem der Menschenaffen, wie den Gorillas, den Orang-Utans oder auch den mit den Menschen genetisch am stärksten verwandten Menschenaffen wie den Schimpansen (pan troglodytes) oder den Bonobos (pan paniscus), wo ausschließlich die Mütter die erste und einzige Quelle von Körperwärme, Fortbewegung, Ernährung und Sicherheit sind. (ebenda, S. 101).
Blaffer Hrdy führt weiter aus:
„Bei Schimpansen, die ebenfalls langsam heranwachsen, werden Jungtiere insofern mit Nahrung versorgt, als ihre Mütter sie nach Nahrung greifen lassen… Doch nur bei Menschen beginnt mütterliches und alloelterliches Nahrungsteilen in den ersten Lebensmonaten und wird dann jahrelang fortgeführt. Auf vorgekaute Säuglingsnahrung folgt „Fingerfood“, und darauf wiederum Nüsse und gekochte Wurzeln, die von Großmüttern und Großtanten gesammelt und oft mühsam zubereitet werden – sowie die köstlichsten Speisen überhaupt, Honig und Fleisch, die der Vater, der Onkel oder andere Jäger mitbringen“. (ebenda, S. 117).
Blaffer Hrdy spricht explizit von der „Schenkbereitschaft“ der Menschengattung. Sie erläutert:
„Fälle von nichtmenschlichen Tieren, die in echter Großzügigkeit freiwillig einen Leckerbissen anbieten, sind selten, außer bei Arten, die, wie der Mensch, eine intensive evolutionäre Geschichte der sogenannten kooperativen Jungenaufzucht haben, bei der Jungtiere gemeinsam umsorgt und ernährt werden. Unter den höheren Primaten genießt der Mensch wegen seiner ständigen Bereitschaft, kleine Gefälligkeiten zu tauschen und Geschenke zu machen, eine Sonderstellung. (ebenda, S. 42).
Die Entstehung von Matrifokalität auf der Grundlage des kooperativen Aufzuchtverhaltens
Aufgrund dieses für den Menschen ausgeprägten kooperativen Aufzuchtverhaltens, das noch vor der Sprachentwicklung eines der Kennzeichen der Menschwerdung ist, erklärt sich nun, warum sich beim Menschen im Pleistozän das Zusammenleben in matrifokalen Blutsfamilien evolutionsbiologisch als besonders günstig erwies. Schauen wir uns an warum:
Exogamie ist bei den Paniden genetisch angelegt und wird durch Chemotaxis gesteuert. Das bedeutet beim pan paniscus, dass geschlechtsreife Frauen ihre Geburtsgruppe verlassen. Die Töchter emigrieren, die Söhne bleiben in ihrer Geburts-Familie. Pan paniscus ist also virilokal. (Bott, Gerhard, 2009, S. 17). Das ist möglich, weil die Menschenaffenbabys ausschließlich von der Mutter versorgt werden. Das andere – kooperative Aufzuchtverhalten des Menschen – verlangt aber ein matrifokales Zusammenleben, das noch besser verständlich wird, wenn die von Kristen Hawkes und ihrem Team erstmals postulierte Großmutterthese in die früheste Soziobiologie des Menschen mit einbezogen wird.
Großmutterhypothese statt Jagd- und Sex-für-Beute-Hypothese
Da sich inzwischen geklärt hat, dass die Jäger in WildbeuterInnengemeinschaften nicht die Hauptversorger der Sippen waren, da ihre Beute viel zu unsicher für die täglich nötige Kalorienzufuhr war, sondern die tägliche Ernährung der Sippe von den Sammelfähigkeiten der Frauen abhing, ist die von patriarchalen Wissenschaftlern favorisierte Jagdhypothese, welche den Mann als Haupternährer und Versorger der Sippe und die Mutter in ökonomischer Abhängigkeit von ihm, in sich zusammengefallen. Die damit verbundene soziobiologische Lehre „Sex für Beute“ ist also falsch. Stattdessen ist dank der anderen Herangehensweise weiblicher Wissenschaftlerinnen die Großmutter-Hypothese in der Anthropologie angekommen. Forschungen der amerikanischen Anthropologin Kristen Hawkes von der Universität Utah an Großmüttern beim wildbeuterisch lebenden Volk der Hazda zeigten nämlich, dass die eifrigsten Nahrungssammlerinnen die Großmütter und Großtanten waren. Blaffer Hrdy fasst die Forschungsergebnisse von Kristen Hawkes und ihren MitarbeiterInnen an den Hazda in Tansania sowie Paul Turkes Forschungsberichte vom Ifaluk-Atoll und Flinns Berichte von Trinidad, die alle die Großmutterhypothese stützen, wie folgt zusammen:
„…die Vorliebe der Hazda-Männer für prestigeträchtiges Großwild wie Elenantilopen hatte zur Folge, dass sie nur selten Beute machten…. An den meisten Tagen kehrten die Männer mit leeren Händen zurück, und es war die Tag für Tag von Frauen gesammelte Nahrung, die die Kinder satt machte. Hawkes und ihren Mitarbeitern fiel noch etwas anderes auf. Die Sammlerinnen, die morgens als Erste das Lager verließen und am Abend als Letzte zurückkehrten, sowie diejenigen, die die schwersten Lasten trugen, waren (anders als man erwarten sollte) nicht junge Frauen in der Blüte ihrer Jahre. Und es waren auch nicht die Mütter mit hungrigen Kindern, die im Lager auf ihre Rückkehr warteten. Die eifrigsten Nahrungssammlerinnen waren vielmehr alte Frauen mit ledergegerbten Gesichtern, deren Blüte lange zurücklag. In einem wegweisenden Aufsatz mit dem Titel „Hart arbeitende Hazda-Großmütter“ beschrieben die Forscher Großtanten und Großmütter, die, statt die Beine hochzulegen und ihre nicht länger durch die Mühen der Kinderaufzucht belasteten “goldenen Jahre“ zu genießen, härter arbeiteten denn je. Kinder in diesen Wildbeutergruppen, die eine Großmutter oder Großtante hatten, die bei ihrer Ernährung halfen, wuchsen schneller heran. In Zeiten der Nahrungsknappheit hatten diese Kinder höhere Überlebenschancen. Turkes Berichte vom Ifaluk-Atoll, Flinns Berichte von Trinidad und jetzt diese Erkenntnisse über Jäger-Sammler in Tansania wiesen alle auf bemerkenswerte Parallelen zwischen Gruppen mit kooperativer Jungenaufzucht hin. In allen Studien waren es hilfsbereite Alloeltern – ältere Schwestern, Großmütter oder Großtanten -, die Mütter erlaubten, mehr Nachkommen mit besseren Überlebenschancen hervorzubringen“. (ebenda, S. 151/152).
Diese Forschungsergebnisse sind revolutionär, belegen sie doch, dass Großmütter und Großtanten einen enorm wichtigen Beitrag zur Versorgung der nächsten Generation liefern. Begreift man den Beitrag der Großmütter für die nächste Generation als menschenartgerecht, erklärt sich der evolutionsbiologische Nutzen der ungewöhnlich langen Lebensdauer von Menschenmüttern nach der Menopause, und es wird auch deutlich, dass Menschenmänner auch heute noch im Vergleich zu Frauen eine signifikant geringere Lebensdauer haben.
Auf der Basis der Großmutterhypothese schauten sich die britischen Anthropologinnen Rebecca Sear und Ruth Mace noch einmal die Unterlagen einer Studie über die Gesundheit von Mutter und Kind genauer an, die zwischen 1950 und 1980 vom United Kingdom Medical Research Council bei den Mandinka-Ackerbauern in Gambia erhoben worden waren und zu den aufwändigsten Studien zählt, die in einer traditionellen Gesellschaft jemals durchgeführt wurden. Auch die von den Forscherinnen neu interpretierten Ergebnisse dieser Studien verändern die übliche patriarchale Herangehensweise der Anthropologie in bedeutender Weise, lenken sie doch den Blick darauf, dass die höheren Überlebenschancen von Kindern vor allem an ein matrilineares Verwandtschaftsverhältnis gekoppelt ist. Blaffer Hrdy fasst auch die Ergebnisse der britischen Anthropologinnen Sear und Mace zusammen:
„Aus der Sicht eines Madinka-Kindes war es buchstäblich lebensrettend, wenn es eine ältere Schwester hatte, die babysitten konnte, oder eine Großmutter mütterlicherseits, die zusätzliche Nahrung besorgte und sich um das Kind kümmerte. Die Anwesenheit des leiblichen Vaters, von Großeltern väterlicherseits oder eines älteren Bruders hatte dagegen keine messbaren Auswirkungen auf die Überlebenschancen von Kindern. Wenn aber nach dem Verlust des Vaters ein Stiefvater die Bühne betrat, sanken die Überlebenschancen des Kindes deutlich. Ansonsten hatten Väter, wie es die Forscher unverhohlen formulierten, „absolut keinen Effekt auf den anthropometrischen Status oder die Überlebenschancen eines Kindes“ – sofern Allomütter zur Verfügung standen“. (ebenda, S. 154).
Tatsächlich bietet die wissenschaftliche Focussierung auf Großmütter und insbesondere auf matrilineare Großmütter die Lösung dafür, warum sich beim Menschen im Laufe des Pleistozäns das Leben in matrifokalen Blutsfamilien evolutionsbiologisch durchsetzte.
Was bedeutet Matrifokalität?
Matrifokalität bedeutet Mütter im Focus, Mütter im Zentrum und beinhaltete Matrilinearität und Matrilokalität.
Matrilinearität heißt, dass die Verwandtschaft unilinear matrilinear abgeleitet wurde. Bei einer frei gelebten, wechselnden, von den Frauen durch die biologisch verankerte female choice bestimmten Sexualität war individuelle Vaterschaft nicht nachweisbar und deswegen ohne Bedeutung. Wenn individuelle Vaterschaft keine Bedeutung hat, dann ergibt sich daraus, die Abstammung nur über die Mutter abzuleiten. Matrilokalität bedeutet, dass die Töchter die matrilineare Blutsfamilie nicht verließen. Das war die direkte Folge des kooperativen Aufzuchtverhaltens beim Menschen, um die Ernährung ihrer Kinder durch konsanguinale Verwandtschaftsbeziehungen bestmöglich abzusichern.
Matrifokalität bewegte sich biologisch immer innerhalb der von der freien Entscheidung der Frau bestimmten Sexualität, der sogenannten female choice, die Vergewaltigung ausschließt und der ebenfalls biologisch durch Chemotaxis determinierten Inzestschranke. Das bedeutet, dass in der paläolithischen, matrilinearen, wildbeuterisch, egalitär lebenden Blutsfamilie aufgrund der Inzestschranke die geschlechtsreifen Brüder nicht matrilokal lebten und stattdessen nicht blutsverwandte Männer als Sexualpartner aus anderen Sippen sozial und ökonomisch eingegliedert wurden. Das bedeutet, wir haben im größten Teil des Pleistozäns ein kollektives fürsorgliches Väterbewusstsein, jedoch kein individuelles, aus dem sich „Väterrechte“ ableiten lassen. (Armbruster, Kirsten, 2014)
Die Entstehung der Paarungsfamilie mit bilinearer Abstammung
Die beiden Lieblingsthesen der gängigen Anthropologie und der Archäologie, nämlich die „Jagd- und Sex-für-Beute-Hypothese“ und die auf ihr gegründete weitere These, die „monogame Paarungsfamilie mit bilinearer Abstammung“ bereits für den Anfang der Menschheitsgeschichte zu postulieren, und damit zu suggerieren, das Patriarchat habe es schon immer gegeben, diese Thesen erweisen sich als Kardinalfehler patriarchal-ideologisch geprägter „Wissenschaft“. Das schöne Wort „Kardinalfehler“ verweist auch gleich auf eine weitere Ideologie, dem dieser Fehler ebenso zugrunde liegt: dem Kardinal, und so entlarvt Sprache bis heute das Patriarchat. Wen wundert es, basiert doch auch die Entstehung von Sprache im Pleistozän auf Muttersprache und damit Mutterkultur.
Wie Gerhard Bott in seinem ebenfalls revolutionären Buch „Die Erfindung der Götter“ (Band 1: 2009 und Band 2: 2014) logisch brillant abgeleitet hat, entwickelt sich die Paarungsfamilie und die damit verbundene bilineare Vater-Mutter-Abstammung erst im Laufe des Neolithikums im Zuge der ökonomischen Implementierung von Tierzucht in Form von Herdenhaltung. Mit der Herdenhaltung einher geht ein verändertes Bedeutungsverständnis von männlicher Fruchtbarkeit, welche der weiblichen im Zuge der Herdenhaltung überlegen zu sein scheint, denn im Zuge der Herdenhaltung von Tieren erfahren die Männer, dass nur wenige männliche Tiere ausreichen, um eine weibliche Herde zu begatten. (Armbruster, Kirsten: Das Muttertabu, 2010, S. 187). Bott schreibt: über den Wandel der unilinear matrilinearen Blutsfamilie zur bilinearen Paarungsfamilie im Modus II/III des Neolithikums:
„Erst jetzt wandelt sich die matrilineare Unilinearität des Verwandtschafts- und Gesellschaftssystems zur Bilinearität, d.h. erst jetzt wird die unilineare Matrilinearität des Verwandtschaftssystems ergänzt durch patrilineare Verwandtschaft. An die Stelle der allein auf die Mutter bezogenen Blutsfamilie tritt die auf die Eltern bezogene Paarungsfamilie, die auch als Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft institutionalisiert wird, und zwar vom Mann, eine neue Familienform, welche die Blutsfamilie ersetzt und zersetzt, indem das genossenschaftliche Gesamthandseigentum privatisiert wird zum Privateigentum… Erst mit der neolithischen Paarungsfamilie, die durch die Heilige Hochzeit geheiligt wird…, kann der Mann Patrilinearität, Patrilokalität der Exogamie und Patrifokalität durchsetzen“. (Bott, Gerhard, 2009, S. 130).
In diesem Zusammenhang sei noch einmal ausdrücklich auf den falschen und irreführenden Matriarchatsbegriff hingewiesen. Wie in dieser soziobiologischen Freilegung von Matrifokalität deutlich sichtbar wurde, hat es eine Mütterherrschaft – was der Spiegelbegriff Matriarchat zu Patriarchat assoziiert – nie gegeben, weshalb der Begriff schon an sich unsinnig ist. Noch unsinniger wird er allerdings durch die Matriarchatsdefinition von Heide Göttner-Abendroth, die ausgerechnet die „Heilige Hochzeit“- auch noch in der neusten Auflage ihres Buchs „Die Göttin und ihr Heros“ (2011) -, zum Kernstück eines angeblichen Matriarchats erhoben hat, womit sie ihre völlige Unkenntnis der soziobiologischen Menschheitsgeschichte offenbart und durch diese Unkenntnis gleichzeitig untermauert, dass der Matriarchatsbegriff in jeder Hinsicht abzulehnen ist, weil er großen Schaden bei der patriarchatskritischen Freilegung menschlicher Geschichte anrichtet.
Schlussfolgerung: Matrifokalität und das Fehlen von Krieg
Zum Abschluss dieser evolutionsbiologischen Abhandlung zur Menschheitsgeschichte, welche die neusten evolutionspsychologischen Erkenntnisse eines empathischen, altruistischen, schenkbereiten, hypersozialen Ursprung des Menschen mit der soziobiologischen matrifokalen Lebensform des Menschen kausal in Zusammenhang stellt, sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass menschliche Kultur im Pleistozän und auch noch in weiten Teilen des Neolithikums geprägt ist durch das Fehlen eines der Hauptmerkmale des Patriarchats, nämlich dem FEHLEN VON KRIEG. Gewalttätige Auseinandersetzungen in Gruppen konnte die Archäologie nämlich erst im Laufe des Neolithikums um 6300 v.u.Z. in der Ofnethöhle im süddeutschen Nördlinger Riess feststellen, wo an sechs Schädeln Hiebverletzungen nachweisbar waren. Der nächste Fund, der auf Gewalteinwirkung schließen lässt, konnte archäologisch erst wieder eintausenddreihundert Jahre später, 5000 v.u.Z. ebenfalls in Deutschland, in Talheim bei Heilbronn ausgemacht werden. Das Kriegszeitalter selbst beginnt mit der Bronzezeit, dem ersten Auftauchen von Streitwagenkriegern ab 3300 v.u.Z. im Vorderen Orient und ist eng korreliert mit der Metallgewinnung durch Bergbau und der Pferdedomestikation, die Voraussetzung waren für Reichsgründungen durch kriegerische Eroberung und interessanterweise mit der erstmaligen namentlichen Nennung von Göttern und Göttinnen zeitlich einhergehen. (siehe Zeittafel der menschlichen Geschichte).
Das bedeutet, dass die Menschheit den allergrößten Teil ihrer Geschichte ihrer hypersozialen Natur gemäß in Frieden lebte, was eine soziologisch kulturelle Großleistung und der Tatsache geschuldet ist, dass die Mütter im Zentrum menschlicher Gemeinschaft standen. Matrifokalität war also nicht nur die Voraussetzung für menschliche Kulturentwicklung, sondern auch der Garant für Frieden. Es bedeutet auch, dass mit der Zerstörung von Matrifokalität wenig später das Kriegszeitalter beginnt, dessen Heroisierung Gegenstand der geschriebenen patriarchalen History ist, während die Herstory, die wesentlich längere und kulturell bedeutungsvolle Menschheitsgeschichte der Matrifokalität von der patriarchalen Geschichtsschreibung unterschlagen wird.
Literatur
Armbruster, Kirsten: Das Muttertabu oder der Beginn von Religion, 2010
Armbruster, Kirsten: Matrifokalität – Mütter Im Zentrum, 2014
Blaffer Hrdy, Sarah: Mütter und Andere; Wie uns die Evolution zu sozialen Wesen macht, 2009
Bott, Gerhard: Die Erfindung der Götter, Essays zur Politischen Theologie, 2009 und 2014
Flinn, Mark V.: Household composition and female reproductive strategies in a Trinidadian village in: The sociobiology of sexual and reproductive strategies, hg von A. E. Rasa, C. Vogel und E. Voland, 1989, S. 206 – 233
Göttner-Abendroth, Heide: Die Göttin und ihr Heros, 2011
Hawkes, Kristen, J.F.O´Conell und N.G. Blurton Jones: Hardworking Hadza grandmothers in Comparative socioecology; The behavioral ecology of humans and other mammals, hg. Von R.A. Foley, 1989, S. 341 – 366
Hawkes, Kristen, J.F.O´Conell und N.g. Blurton Jones: Hadza women´s time allocation, offspring provisioning and the evolution of post-menopausal lifespans; Current Anthropology, 38, 1997, S. 551 – 577
Sear, Rebecca, Fiona Steele, Ian A. McGregor und Ruth Mace: The effects of kin on child mortality in rural Gambia; Demography, 39, 2002, S. 43 – 63
Sear, Rebecca: Kin and child survival in rural Malawi. Are matrilineal kin always beneficial in a matrilineal society? Human Nature, 19, 2008, S. 277 – 293
Tomasello, Michael, Malinda Carpenter, Josep Call, Tanya Behne und Henrike Moll: Understanding and sharing intentions. The origins of cultural cognition: Behavioral and Brain Sciences 28, 2005, S. 675 – 691
Turke, Paul: Helpers at the nest; Childcare networks on Ifaluk in: Human reproductive behavior. A Darwinian perspective, hg von L. Betzig, M. Borgerhoff Mulder und P. Turke, 1988, S. 173 – 188
